|
|||
|
Im Tal der Könige und Kapeiken
Eigentlich ist es ja das Tal nur eines Königs, das „Tal des Großen Königs“ oder „Valle Gran Rey“, wie es auf La Gomera heißt. Aber der letzte seiner Art, der Guanche, Hautacuperche, wurde 1488 von den Spaniern nieder¬gemacht, weil der den vertragsbrüchigen „Grafen von Gomera“, den Conde Hernán Peraza bei einem schlau vorgegaukelten Schäferstündchen mit einer nativen Schönen gemeuchelt hatte. Die Krieger des Guanchenhäuptlings, alle Männer über 15, wurden praktischerweise samt und sonders zum Tode verurteilt, während die Frauen nebst Kindern, nächstengeliebt, in die christliche Sklaverei verkauft wurden. Damit machten die spanischen Granden diese Insel letztendlich frei für die Touristen. Zunächst aber einmal für jene arm¬seligen spanischen Kleinbauern, die den Lorbeerwald rodeten, an den steinigen Hängen Terrassen anlegten, Trockenmauern aufschichteten, den kargen Boden hackten, Zisternen gruben, Bewässerungskanälen aushoben, Saumpfade zogen und geduckte Häuschen aus Geröllsteinen aufschichteten. Sie bauten Rüben, Mais und Kartoffeln an, versüßten ihr Leben mit Bananen und Wein, hielten Esel, Schafe und Ziegen, fingen Fische und verkauften den knappen Überschuß an Schiffe, die- so wie einst Christopher Kolumbus – vor der Atlantiküberquerung hier nochmals kurz vor Anker gingen, um Wasser zu fassen. All das lag natürlich in den Händen und gelangte in die Taschen jener Granden, die das spanische Mutterland mangels besserer Verwendung auf den gott- und guanchenverlassenen Felsen im Atlantik entsandt hatte. Hier waren sie quasi Großkönige im Kleinbauerntal. Als die Schiffe ausblieben, weil sie – nun dampfgetrieben – nicht mehr den Passatwinden zu folgen brauchten, gab es andere, die in der Insel das nun schnell erreichbare, tropische Gewächshaus Europas entdeckt hatten, so daß sich die Bauern schließlich mit Tomaten- und Bananen¬exporten ein dürftiges Ein- und Auskommen sicherten. Die Großgrundbesitzer, die den Handel abwickelten, verdienten sich damit ansehnliche Palacios, die selbst einen Vergleich mit den Festlandsvillen aushalten konnten. Dann – in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts – eroberten geschmacksneutrale holländische Produkte unter dem Namen ‚Tomate’ den europäischen Markt, während die südamerikanischen Superbananen im Auftrag von United Fruit & Friends die kleinen, schmackhaften Inselbanänchen von den Obstregalen des Kontinents schubsten. So wanderten etliche Insulaner ab, vornehmlich nach Venezuela, wo sie sich im Ölgeschäft verdingten. Zurück blieb eine öde, sonnen¬verbrannte Bananeninsel mit verfallenden Terrassen und vor sich hindösenden Alten in verlassenen Weilern, irgendwo im Atlantik, abseits von Teneriffa mit seiner europäischen Badegesellschaft. Es sollte kein Jahrzehnt dauern, bis eine zivilisationsmüde Jugend, flowergepowert, die Strände für sich entdeckte. Platz genug, – gab es doch 1970 ganze fünf Touristen auf der Insel. Weg mit den Hemdchen und Höschen, her mit dem Hasch! Einige von ihnen sind nach einem rauschhaften Leben in die sozial helfende Heimat zurückgekehrt, andere ruhen in den ‚Apartmementos Definitivos’, wie man das irdische Endlager gelegentlich nennt, übrige haben Wurzeln geschlagen, endogene Partner gefunden, oft auch Ableger hervorgebracht und die spanische Hälfte in die Erwerbstätigkeit getrieben. Einige gar haben sich zu kleinen Großkönigen gemausert. Dem Hautacuperche hat man jetzt, 520 Jahre nach seinem gewaltsamen Ende, ein Denkmal gesetzt. Da steht er nun, 4 Meter hoch, in Bronze gegossen, den muskulösen Rücken zum Meer, den festen Blick auf seine Talschlucht gerichtet– versperrte ihm nicht das Hotel „Gran Rey“, das mit seinem guten Namen wirbt, den Blick ins Valle. Sein Körper durchtrainiert wie nach Ablauf eines wohlgenutzten Jahres-Abos in der Muckibude: würde er sich auf die Zehen stellen, könnte er vielleicht oben in den Bergen zum Hof der Königin der Könige hinschauen. Nein, nicht zu dem untergegangenen Anwesen seiner Gattin. Die hat vielleicht Kolumbus mit an Bord seiner – wie passend der Name – „Santa Maria“ genommen, als er 1492 von hier aus nach Westen segelte. Gott bewahre! Es ist die „Nuestra Senora de Los Reyes Santos“, eben wieder die Gottesmutter Maria, der die Kapelle da oben geweiht ist. An dieser Stelle ist sie also Herrin der „Heiligen Drei Könige“, die ihrerseits natürlich einen ehedem hingerafften heidnischen Großkönig, den „Gran Rey“, lässig toppen. Und nicht ganz zufällig ist das Kirchlein unten am Talausgang jenen „Tres Reyes Santos“ gewidmet, eben den besagten Heiligen Drei Majestäten, womit die Hierarchie von der Madonna über die Könige bis zu den Kapeiken – wie man die Gestrandeten hier liebevoll-spöttisch nennt – hergestellt ist. Und jedes Jahr, von Mariä Empfängnis bis Epiphanias, am 6. Januar also, zieht eine eindrucksvolle Prozession von Priestern und Meßknaben, von Musikanten und Volkstänzern, von Bacchanten, Zugereisten und Touristen (allesamt beiderlei Geschlechts, Priester und Meßknaben ausgenommen) – fiesta-bewegt den Berg hinauf. So gehuldigt, akzeptiert die Himmels¬königin ihre gewaltsame Inthronisation, mit dem ihr die Herrschaft und den Ankömm¬lingen die Macht über das Tal übertragen wurde. Gran Rey hin, Nestra Senora her, die Irdischen haben sich eingerichtet. Und was die „Heiligen Drei Könige“ betrifft, so bleibt deren Rolle nie unbesetzt. Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten sie. Und von weit her gekommen sind sie zudem. Wir brauchen nicht lange zu suchen, wollen wir ihre Stellvertreter auf Erden– nein, im Tale reicht – ausfindig machen. Caspar, das ist der umtriebige, der für das Gold steht, damals die materielle Gabe für den jungen Weltenkönig, Christus. Nennen wir den Magier hier und heute Don Carlos. Irgendwo in Gallizien geboren, verschlug es den kleinwüchsigen Quirl nach Bremen, wo er sich vom Kellner zum Betreiber zahlreicher Lokalitäten emporarbeitete, Werder und den Lemke Willi coachte, einen Sohn zeugte, in der Noch-DDR ein griechisches Restaurant eröffnete, obwohl er selber nicht einmal spanisch zu kochen versteht, um sich endlich ruhesuchend nach La Gomera zurückzuziehen. Hier rackert sich der rastlose Wanderer ab, die – bibelnah gesprochen: – Ziegenställe besitz- und sonnenmüder Insulaner an besitz¬¬- und sonnesuchende Teutonen zu verschachern. Der Erbprinz, ein schmucker junger Mann aus Bremen mit etwas Heimweh nach Deutschland, hilft nach Kräften. Gehörten Don Carlos all die Bauten, an denen sein Schild prangt, dann schlüge er gar König Salomo, den unermüdlichen Palästlebauer. Doch nicht genug: Neben diesen Hausgeschäften betreibt er (ab 14 Uhr mit Nachrichten auf Deutsch) nun auch eine Radiostation, die sein Ego sogar per Internet um den Erdkreis verbreitet, da ihm fast das ganze Eiland hört und gehört, - gäbe es nicht die beiden anderen Majestäten. Melchior ist jener, der damals den neuen Weltenherrscher mit Weihrauch beschenkte. Damit huldigt er dem Himmelskönig, Christus. Nicht von ungefähr heißt es, daß man jemanden, den man schönfärben möchte oder muß, beweihräuchert. Capitano Claudio – Klatschonkel deutscher Herkunft, Gondoliere der Walgucker und Segelmultitalent – verfaßt und vertreibt den „Valle-Boten“, eine schnoddrige Gazette, „das ultimative Insel-Magazin, unabhängig, überparteilich und abgedreht“. Vor allem „abgedreht“. Wenn des morgens die 12 grünen Flügeltüren seines Amtsitzes aufgeklappt sind, erspäht man ihn im Halbdunkel seiner Höhle, wo er sein nächstes Ei bebrütet. Eigentlich sieht er eher harmlos aus, ein frühpensionierter, hagerer Finanzbeamter mit silbergrauem Seemannsbart. Doch im Gegensatz zum Steuerbescheid ist sein Blatt den Touris eine begehrte Ferienpostille, den Germano-Gomanchen aber eher die unbequeme Pflichtlektüre. Wen beweihräuchert er heute mit artigen Worten (die Werbeanzeige folgt meist auf derselben Seite), und wen überzieht er (werbemufflig oder nicht) mit Hohn und Spott? Balthasar, der dritte der glorreichen Drei, bringt Myrrhe. Mit dieser Gabe soll der Körper des gekreuzigten Dornenkönigs vor dem endgültigen Verfall bewahrt werden. Wer könnte diese Aufgabe heute besser übernehmen als El Fotografo? Auch ihn, ein hochgewachsener Gottschalktyp im überreifen Alter, scheint die bewegte Blumenzeit hier angespült zu haben. Doch mit seinem erlernten Können und dem archivierten Bildmaterial hat er den größten Fotoschuppen des Tals errichtet und sich, ergo, einen prachtvoll auf- und überragenden Herrschersitz erbaut, von dessen ‚Daches Zinnen’ er mit über das Valle blicken kann. Da aber zum Leben am Hofe Kunst und Kastelle gehören, hat er zudem auch mit viel Mut und Mitteln einen alten Bananenkai am Meer zum kulturbetreibenden „Castillio del Mar“ umgebaut und somit vor der Vergänglich¬keit bewahrt. Wen wundert es da schon, daß er Kultur wiederbelebt, wo es seit Gomanchengedenken nie welche gegeben hat? Allerdings hat der verschollene Kran des martialischen Außenpostens im Meer, damals zur Zeit der Bananenkönige, das erste Auto an Land gehievt, was man vermutlich als einen Beitrag zur Zivilisationsgeschichte ansehen muß.
Auch Könige, so verdienstvoll sie auch sind, kommen in die Jahre. Die nächste Generation der Deutschen ist längst schon per Billigflug und Schnellfähre hier angekommen, hat den schwarzen Sand der ersten, wilden Strandtage abgeschüttelt und treibt nun das, wovor sie zunächst weggelaufen sind: Und es gibt auch sie noch, die Gestrandeten, die an der Playa ihr Auskommen suchen, Kaffee aus der Thermoskanne verkaufen, spendenhungrig musizieren, modellieren oder jonglieren, um dann vielleicht zu inhalieren oder injizieren. Wenn hinter Hatacuperches Rücken die Sonne bei Hiero rot im Atlantik versinkt, dann wiegen sie sich im Rhythmus der Trommler und träumen über den Rand der Bierdose hinweg von einem schöneren Morgen. Der bronzene Guanchen-fürst, den Speer in der Linken, streckt seinen geborstenen Friedenspokal den Kapeiken, Kellnern und Königen im Tal anklagend entgegen. Er wird der erste sein, der morgen die Sonne aufgehen sieht, wenn sie rotgolden über den Kamm des Berges klettert. |
|||
|
|||
|
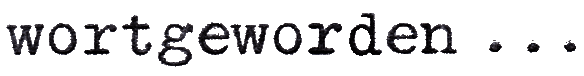
 Foto: Albe
Foto: Albe


